| Dissektionsmikroskop aus 1868. Das Instrument ist aus zaponiertem,
sowie schwarz und braun gebeiztem Messing, gebläutem und schwarz lackiertem
Stahl gefertigt.
Zur Beleuchtung dient ein großer Planspiegel, der dreifach gelagert
ist und damit für schiefe Beleuchtung aus der Achse bewegt werden kann.
Unter dem Tisch ist zur Regulierung eine Lochblendenrevolverscheibe mit 5
Aperturöffnungen angebracht. Objektklemmen sind für den Tisch des
Mikroskops nicht vorgesehen.
Die Einstellung erfolgt über einen Prismentrieb, der den Tubusträger
direkt auf dem Prisma sitzend relativ zur Tischfläche bewegt. Das Triebrad
lässt sich mit der Hand bequem auf dem Tisch liegend bedienen.
Der Fuß dieses Mikroskops ist aus schwarz lackiertem Stahl gefertigt,
welches auf der Unterseite wie für Merz typisch mit vier eingelassenen
Lederpolstern versehen ist, um dem Mikroskop Standfestigkeit zu geben und
die Schreib- oder Arbeitstischplattenfläche nicht zu beschädigen.
  Am
unteren Rand der Tischplatte sind Schwalbenschwanzführungen angebracht,
die ursprünglich dazu dienen sollen Handauflagen anzubringen, diesem
Mikroskop waren solche jedoch nicht beigegeben, denn es sind keinerlei
mechanische Spuren an diesen Stellen zu erkennen, ferner deckt sich dies
mit dem Eintrag im Kassenbuch der Firma. Am
unteren Rand der Tischplatte sind Schwalbenschwanzführungen angebracht,
die ursprünglich dazu dienen sollen Handauflagen anzubringen, diesem
Mikroskop waren solche jedoch nicht beigegeben, denn es sind keinerlei
mechanische Spuren an diesen Stellen zu erkennen, ferner deckt sich dies
mit dem Eintrag im Kassenbuch der Firma.
Der Tubus entspricht in der Form jenem der mittleren Merz-Stative ohne Grobtrieb,
er wird über das Objektivgewinde und einem Adapter verbunden, welcher
einerseits als Aufnahme für das dreiteilige Objektiv dient und andererseits
die Verbindung zum geschwungenen Tubusträger darstellt.
Das Instrument ist ausgestattet mit dem Okular
1 und
2.
Der Einrichtung des Kastens nach zu urteilen, wird dieses Instrument nur
mit dem einen montierten Objektiv und einem Okular ausgeliefert.
Auf dem Tubus befindet sich die dekorative Signatur:
G. & S. Merz
in München
No. 890 |
| Im Erlenholzkasten wird das Mikroskop demontiert aufbewahrt. Dieser Kasten
zeigt den für die kleineren Mikroskopstative von Merz typischen Schieber
zum Verschluß des Behältnisses. Dieser Schieber trägt auf
der Innenseite eine Beschreibung des ersten Besitzer dieses Mikroskops: |
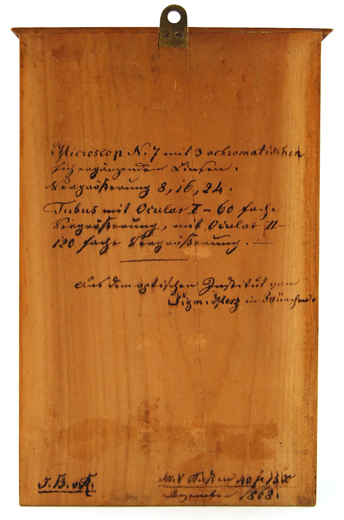 |
Microscop N. 7 mit 3 achromatischen
sich ergänzenden Linsen.
Vergrößerung 8, 16, 24
Tubus mit Ocular I - 60 fache
Vergrößerung, mit Ocular II -
120 fache Vergrößerung. -
---
aus dem optischen Institut von
Sigmund Merz in München
|
| J.B. v. R. |
Mit Kasten 40 fl 15
gr.
Dezember 1868 |
|
|
 Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende
Eintragungen: Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende
Eintragungen:
| 1868 |
[...] |
| December |
16 |
Baron von Ruprecht hier |
|
|
|
|
|
|
1 Microscop No VII laufende No 890
Praeparirmicroscop ohne Flügel aber mit Tubus
mit Ocular 1, Vergr. 8, 16, 24, 60 |
35 |
- |
35 |
- |
[...] |
| December |
23 |
Baron von Ruprecht hier |
|
|
|
|
|
|
1 Ocular No 2 für das Microscop |
5 |
15 |
5 |
15 |
Die handschriftliche Eintragung auf der Rückseite des Kastens stammt
damit vom Besitzer, Baron J. v. Ruprecht, der 6 Tage nach Erwerb des Mikroskops
ein zweites Okular nachkauft. Im deutschen Adel findet sich nur ein passender
Eintrag der auf einen Baron bzw. Freiherrn mit gleich klingendem Familiennamen
verweist (Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen
Häuser. Jahrgang 49. Justus Perthes, Gotha 1899: 840), wenn
auch inminimal abweichender Schreibweise: Hierbei handelt es sich um den
königlich bayrischen Oberförster Johann Nepomuk Freiherr von Rupprecht
(Amberg 1807 - München 1883). |
 |
Es ist bisher noch ein weiteres Stativ gleicher Bauart mit der Seriennummer
905 bekannt.
 |
|
Das Preisverzeichniss der Mikroskope aus dem Institute von G. &
S. Merz, vorm. Utzschneider & Fraunhofer in München. (1869) listet
dieses Stativ sowie das kleinere
Pendant wie folgt (Heinrich Frey: Das Mikroskop und die mikroskopische
Technik. Leipzig, Wilhelm Engelmann 1871: 380-381):
A. Komplete Mikroshope.
[...]
 Mikroskop Nr. 7 (Dissektions-Mikroskop), Mikroskop Nr. 7 (Dissektions-Mikroskop),
Tisch mit Flügel, Einstellung durch Trieb, Beleuchtung in und ausser
der Axe. Das Instrument besitzt 3 achromatische, sich zu einem
1/3" System ergänzende Linsen und ein terrestrisches
ocular nebst Auszug.
Vergrösserung 8, 16, 24 und 40-200
Preis 56 fl. = 32 Thlr.
Mikroskop Nr. 7a
(Einfaches Dissektions-Mikroskop).
Gleiche mechanische Aussattung, achromatische Linsen, Vergrösserung
8, 16, 24
Preis 241/2 fl. = 14 Thlr.
Dieses Mikroskopstativ taucht ohne Zubehör als einziges Mikroskop im
Angebot eines Antiquitätenhändler bei einer Messe in Los Angeles
auf, Stuart Warter erwirbt das Stativ von dem anbietenden Händler mit
dem Versprechen, die zugehörigen weiteren Teile und den Kasten
nachzuliefern. Tatsächlich findet jener Händler die fehlenden Teile
in seinem Bestand wieder und Stuart Warter fährt in das entsprechende
Ladengeschäft in einem guten Viertel Los Angeles, um das Instrument
wieder zu vervollständigen. Im Mai 2011 wird das Mikroskop schließlich
zur weiteren Vervollständigung der Sammlung von Stuart Warter an diese
Sammlung zu seinem ursprünglichen eigenen Einkaufspreis verkauft. |
|
Der am 26. Januar 1793 in Bichl bei Benediktbeuren geborene
Georg Merz besucht zunächst die Schule
im benachbarten Stift und hilft seinem Vater, einem Leinweber, auf dem Felde
in der Landwirtschaft. Als Utzschneider in Benediktbeuren eine Fabrik zur
Herstellung von Flint- und Crownglas für sein optisches Institut errichtet,
tritt Merz dort 1808 als Arbeiter ein.
| Angeregt von einem der Padres des mittlerweile säkularisierten Klosters
studiert Merz in seiner freien Zeit mit großem Eifer Mathematik und
Optik. Fraunhofer erkennt die außerordentliche Begabung des jungen
Arbeiters und ernennt ihn zum Werkführer der optischen Abteilung.
Mit dem Tode Fraunhofers übernimmt Merz 1826 die Geschäftsleitung
und wird zum Direktor der optischen Abteilung. Zusammen mit dem Mechaniker
Franz Joseph Mahler wird er 1830 Teilhaber und 1839 Eigentümer des
Instituts. Nach dem Tode Mahlers 1845 führt Georg Merz das Institut
weiter unter Mitarbeit seiner Söhne Sigmund (1824 - 1908) und Ludwig
(1817 - 1858). Das Institut wird nach München verlegt und die Signatur
lautete "G. Merz & Söhne in München".
Hermann Schacht beschreibt 1855 in Das Mikroskop und seine Anwendung,
insbesondere für Pflanzen-Anatomie (Verlag von G.W.F. Müller,
Berlin 1855: 6), dass Merz & Söhne zusammen mit den meisten deutschen
Optikern das Hufeisenstativ nach Oberhäuser angenommen haben.
Ludwig Merz stirbt 1858 mit 41 Jahren an Bleivergiftung, die er sich bei
der Flintglasherstellung in Benediktbeuren zuzieht. Danach firmiert das Institut
mit: "G. & S. Merz in München". |
 |
 |
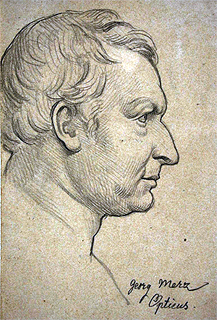 1865
erreichen Mikroskope von Merz zusammen mit Instrumenten von Hartnack ein
in jener Zeit unübertroffenes Auflösungsvermögen. Georg Merz
stirbt am 12. Januar 1867. 1865
erreichen Mikroskope von Merz zusammen mit Instrumenten von Hartnack ein
in jener Zeit unübertroffenes Auflösungsvermögen. Georg Merz
stirbt am 12. Januar 1867.
Nun ist Sigmund alleiniger Inhaber des Institutes. Im Jahr 1871 hat das
Unternehmen 63 Beschäftigte und signiert "G. & S. Merz (vormals
Utzschneider & Fraunhofer) in München". 1883 übergibt
Sigmund Merz die Münchner Werkstätte an seinen langjährigen
Gehilfen und Vetter Jakob Merz (1833 - 1906), dieser verkauft die
traditionsreiche Firma am 5. Oktober 1903 an Paul Zschokke (1853 -
1932).
Da es unter Fraunhofers Federführung in Bediktbeuren und München
gelungen ist, achromatische Linsenkombinationen zu erstellen, erlangt das
Unternehmen rasch Weltrang. Das Wissen bleibt in der Firma und unter Merz
führt sie noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts im Bau großer
Refraktoren für die Sternwarten Europas. Mikroskope sind, wie schon
unter Joseph von Fraunhofers Leitung,
von eher untergeordneter Bedeutung und daher recht selten. Das optische Glas
wird stets nur für den Bedarf der Werkstätte in der eigenen
Glashütte geschmolzen und nicht als Rohstoff an andere Firmen verkauft.
[Vergleiche Referenz 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 56, 64,
73, 88]
(Mein herzlicher Dank für die Daten aus dem Kassenbuch von Merz
gilt Jürgen Kost, Tübingen sowie für die Recherche des vollen
Familiennamens des Mikroskopbesitzers gilt Dipl.-Ing. Philipp Freiherr von
Hutten, Wien) |
|










 Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende
Eintragungen:
Auf Seite 57 des Kassenbuchs von Merz finden sich folgende
Eintragungen: