| Trommelmikroskop von Krüss; um 1858. Hohes Trommelstativ
aus zaponiertem und geschwärztem Messing sowie gebläutem Stahl.
Das Instrument verfügt über einen Tubus fester Länge, zur
Beleuchtung dient ein schwenkbarer Konkavspiegel, abgeblendet wird durch
eine Lochblendenrevolverscheibe die von der Rückseite des Stativs aus
bedient wird. Die grobe Einstellung erfolgt über den Schiebetubus, der
Feinfokus wird durch eine in einer Federhülse geführte
Rändelschraube seitlich am Tisch ermöglicht, welche dessen Platte
auf der optischen Achse hebt und senkt.
 Auf dem Tubus ist das Mikroskop sehr dekorativ in deutscher
Schreibschrift signiert: Auf dem Tubus ist das Mikroskop sehr dekorativ in deutscher
Schreibschrift signiert:
No 191.
A.Krüss.
Hamburg.
Das Instrument ist mit drei Okularen und zwei dreifachen Satzobjektiven Nr.
3 und Nr. 6
ausgestattet. Die einzelnen Linsen der Objektive sind in breiten Ringen gefasst
und dort mit kleinen Schlagzahlen nummeriert. Aufbewahrt werden die Objektive
in einem kleinen samtgefütterten Kästchen aus poliertem Mahagoniholz.
An weiterem Zubehör verfügt das Mikroskop über eine sogenannte
"feuchte Kammer", eine zaponierte Messingpinzette und eine Präpariernadel,
eine zweite solche Nadel und das Skalpell des Präpariersets sind nicht
mehr erhalten. |
  Liegend wird das Mikroskop in einer Mahagonischatulle im Stil
französischer Instrumente der 1860er untergebracht. Liegend wird das Mikroskop in einer Mahagonischatulle im Stil
französischer Instrumente der 1860er untergebracht.
Dieses Mikroskop wird nach Aussage des Verkäufers während des Zweiten
Weltkriegs von einem US-amerikanischen Soldaten im eroberten Deutschland
"mitgenommen". Im Fabruar 2006 kann das Instrument aus dem Tal des Hudson,
New York, für diese Sammlung erworben werden.
Pieter Harting schreibt über dieses kleine Mikroskopstativ im Jahre
1866:
Derselbe [Krüss] verfertigt Mikroskope in der Form der kleinen
Microscopes coudés von Oberhäuser und von Schiek, und zwar um
den beispiellos niedrigen Preis von 20 Thaler. Nach Wagner [Rud. Wagner
in: Nachrichten v. d. G. A. Universität u. d. Königl. Ges. der
Wiss. zu Göttingen. 1857, Nr. 19, S. 253] sind sie für den ersten
Unterricht und für die gewöhnlichsten
histologischen Untersuchungen ganz empfehlenswerth, da sie eine 300malige
sehr klare Vergrösserung geben, die bei sehr vielen Untersuchungen ganz
ausreicht. Auch die mechanische Einrichtung ist ganz gut. Nach einem
Preiscourante von Jahre 1862 liefert er auch etwas
grössere Instrumente mit 2 Objectiven und 2 Ocularen um 36
Thaler. |
| In einer Werbung der Firma Krüss aus dem Jahre 1868 heißt
es:
 Mikroskope. Mikroskope.
Veranlaßt durch den stets mehr sich herausstellenden Bedarf guter
Mikroskope in den verschiedensten
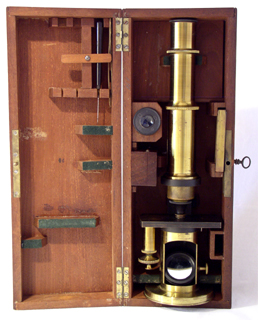 Zweigen der Wissenschaft und Industrie habe ich eine bedeutende
Modifikation meiner Preise ermöglicht, weshalb ich mir erlaube, namentlich
auf die vier unten verzeichneten, am meisten verlangten, Sorten hierdurch
aufmerksam zu machen. Meine Mikroskope zeichnen sich bekanntlich durch Helligkeit
und Schärfe aus und können, dem Urtheile der ersten Sachkenner
zufolge, mit den besten in diesem Fach würdig rivalisiren. Zweigen der Wissenschaft und Industrie habe ich eine bedeutende
Modifikation meiner Preise ermöglicht, weshalb ich mir erlaube, namentlich
auf die vier unten verzeichneten, am meisten verlangten, Sorten hierdurch
aufmerksam zu machen. Meine Mikroskope zeichnen sich bekanntlich durch Helligkeit
und Schärfe aus und können, dem Urtheile der ersten Sachkenner
zufolge, mit den besten in diesem Fach würdig rivalisiren.
Achromatische Mikroskope (Modell Oberhäuser) mit 300maliger
Vergrößerung
1 Okular- und ein Linsensatz...20 Thlr.
Dasselbe mit Polarisationsapparat...26 -
Achromatische Mikroskope (Modell Oberhäuser) bis 520maliger
Vergrößerung mit 2 Okular- und 2 Linsensätzen...34 -
Dasselbe mit Polarisationsapparat...36 -
Die Preise sind preuß. Kurant gegen baare Zahlung [9923]
A. Krüß
Optiker und Mechaniker
Adolphsbrücke Nr. 7 in Hamburg
|
Die Firma A. Krüss Hamburg dürfte wohl eine der ältesten noch
in Familienbesitz befindlichen optisch-mechanischen Werkstätten Deutschlands
sein.
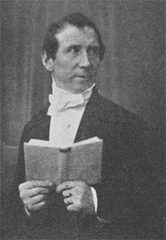 Edmund Gabory wird in Straßburg
(Elsaß) geboren und geht als Schüler beziehungsweise Mitarbeiter
von Ramsden (seinerseits ein Schüler Dollonds) nach London. Bereits
in London-Holborn macht sich Gabory 1790 selbständig, übersiedelt
aber mit seiner Familie 1796 nach Hamburg um dort eine Werkstätte als
Opticus und Mechanicus zu eröffnen. An der Neuenburg Nr. 14 werden optische,
mechanische und frühe elektrische Instrumente hergestellt und verkauft
- der Giebel des Hauses dient dabei als privates Observatorium. In seiner
Freizeit hält der Firmeninhaber öffentlich wissenschaftliche
Vorträge zur Optik und Elektrizität. Edmund Gabory wird in Straßburg
(Elsaß) geboren und geht als Schüler beziehungsweise Mitarbeiter
von Ramsden (seinerseits ein Schüler Dollonds) nach London. Bereits
in London-Holborn macht sich Gabory 1790 selbständig, übersiedelt
aber mit seiner Familie 1796 nach Hamburg um dort eine Werkstätte als
Opticus und Mechanicus zu eröffnen. An der Neuenburg Nr. 14 werden optische,
mechanische und frühe elektrische Instrumente hergestellt und verkauft
- der Giebel des Hauses dient dabei als privates Observatorium. In seiner
Freizeit hält der Firmeninhaber öffentlich wissenschaftliche
Vorträge zur Optik und Elektrizität.
Während der Besetzung Hamburgs durch Napoleon 1811 darf Gabory sein
Geschäft zwar weiter betreiben, alle englischen Waren werden jedoch
verbrannt und die besten Fernrohre von den Besatzern für eigene Zwecke
beschlagnahmt.
Ende 1813 erliegt Edmund Gabory den Spätfolgen einer Verletzung, die
er sich während seiner Arbeiten zugezogen hat. Seine Kinder Edmund Nicolas
und Mary Ann führen daraufhin das optische Geschäft weiter.
Mary Ann heiratet 1823 Andres Krüss, welcher die Werkstätte nun
mit seinem Schwager gemeinsam weiterführt.
 Andres Krüss wird 1791 auf Helgoland
geboren und ist 1806 bei einem der Hamburger Kaufleute beschäftigt,
die während der Kontinentalsperre ihre Geschäfte von der kleinen
Hochseeinsel aus betreiben. Als Blockadebrecher ist er schon in diesem jungen
Alter erfolgreich und zieht schließlich 1814 nach Hamburg. Hier wird
er 1823 Bürger. Während nach dem Tod seines Schwiegervaters die
Selbstanfertigung von Instrumenten zunehmend zurückgegangen ist, lebt
diese mit Andres Krüss wieder auf. Es werden alle von Seefahrern benutzten
Instrumente sowie zugehörige Karten verkauft. Das umfangreiche optische
Lager bringt einen florierenden Handel nach Skandinavien und auch Übersee
mit sich. Edmund Krüss, der älteste Sohn von Andres Krüss
wird von seinem Vater im Frühjahr 1841 im Alter von 17 Jahren nach Stuttgart
zum Hofoptiker und Mechaniker Geiger in die Lehre geschickt. Im Anschluss
daran besucht Edmund Krüss das Stuttgarter Technikum. Andres Krüss wird 1791 auf Helgoland
geboren und ist 1806 bei einem der Hamburger Kaufleute beschäftigt,
die während der Kontinentalsperre ihre Geschäfte von der kleinen
Hochseeinsel aus betreiben. Als Blockadebrecher ist er schon in diesem jungen
Alter erfolgreich und zieht schließlich 1814 nach Hamburg. Hier wird
er 1823 Bürger. Während nach dem Tod seines Schwiegervaters die
Selbstanfertigung von Instrumenten zunehmend zurückgegangen ist, lebt
diese mit Andres Krüss wieder auf. Es werden alle von Seefahrern benutzten
Instrumente sowie zugehörige Karten verkauft. Das umfangreiche optische
Lager bringt einen florierenden Handel nach Skandinavien und auch Übersee
mit sich. Edmund Krüss, der älteste Sohn von Andres Krüss
wird von seinem Vater im Frühjahr 1841 im Alter von 17 Jahren nach Stuttgart
zum Hofoptiker und Mechaniker Geiger in die Lehre geschickt. Im Anschluss
daran besucht Edmund Krüss das Stuttgarter Technikum.
Während des großen Brandes in Hamburg 1842 wird auch das Haus
Neue Burg 4 ein Raub der Flammen. Ausser etwas Bargeld und etwa 20% der Waren
kann Andres Krüss nur wenig vor dem Feuer retten. In der Kleinen
Reichenstraße wird das Geschäft neu eröffnet; nach dem
Heranwachsen der beiden Söhne der Teilhaber trennen sich die
Geschäftspartner jedoch 1844 und Andres Krüss eröffnet das
Optische Institut A. Krüss am 11.11.1844 am Alten Wall. Das Aufblühen
seiner jungen Firma erlebt Andres Krüss leider nur bis er im Revolutionsjahr
1848 einer Cholera-Epidemie zum Opfer fällt. Seine Witwe führt
das Geschäft nun weiter, übergibt es schließlich 1851 an
ihre Söhne Edmund und William.
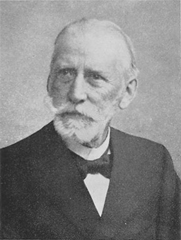 Edmund Krüss kauft im selben
Jahr das Haus Adolphsbrücke 7 und fertigt dort verschiedenste mechanische
Erzeugnisse. 1859 schließlich wird eine Linsenschleiferei eingerichtet,
in der anfangs insbesondere photographische Objektive nach Berechnungen von
Prof. Josef Petzval hergestellt werden. Projektionsapparte werden sehr
erfolgreich mit in das Programm aufgenommen, 1865 läßt sich A.
Krüss die Laterna Magica patentieren. Edmund Krüss kauft im selben
Jahr das Haus Adolphsbrücke 7 und fertigt dort verschiedenste mechanische
Erzeugnisse. 1859 schließlich wird eine Linsenschleiferei eingerichtet,
in der anfangs insbesondere photographische Objektive nach Berechnungen von
Prof. Josef Petzval hergestellt werden. Projektionsapparte werden sehr
erfolgreich mit in das Programm aufgenommen, 1865 läßt sich A.
Krüss die Laterna Magica patentieren.
Während einfache Mikroskope schon ein paar Jahre produziert werden,
wird Mitte der 1860er ein besonders Trichinen-Mikroskop konstruiert. Der
Firmeninhaber Edmund Krüss selbst beschäftigt sich auch selbst
viel mit der Untersuchung trichinenhaltigen Fleisches und sich hieraus ergebende
Vorschriften werden in der Hamburger Tageszeitung veröffentlicht.
Schließlich werden neben Lokomotivmodellen auch kleine Dampfboote um
1860 mit ins Fertigungsprogramm genommen.
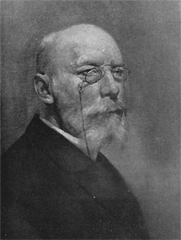 William Krüss tritt 1874 aus dem Geschäft
aus, Dr. Hugo Krüss wird daraufhin 1876 von seinem Vater Edmund Krüss
mit in die Firma aufgenommen. Hugo Krüss war nach einer
technisch-mathematischen Ausbildung bei Dennert & Pape Hamburg in die
Lehre der optisch-astronomischen Werkstatt C.A. Steinheil Söhne
München gegangen - hier schloß sich der Besuch des Polytechnikums
und später der Universität München an. William Krüss tritt 1874 aus dem Geschäft
aus, Dr. Hugo Krüss wird daraufhin 1876 von seinem Vater Edmund Krüss
mit in die Firma aufgenommen. Hugo Krüss war nach einer
technisch-mathematischen Ausbildung bei Dennert & Pape Hamburg in die
Lehre der optisch-astronomischen Werkstatt C.A. Steinheil Söhne
München gegangen - hier schloß sich der Besuch des Polytechnikums
und später der Universität München an.
Als 1886 Alfred Gabory, der Schwager von Edmund Krüss, sein optisches
Geschäft aufgibt, übernimmt die Firma Krüss dessen Lager.
So werden die 1844 getrennten Werkstätten wieder vereint. 1888
schließlich wird der passionierte Naturforscher Hugo Krüss Chef
der Firma seines Vaters, durch ihn konzentriert sich das Unternehmen nun
auch auf die Fertigung von photometrischen und spektroskopischen Apparaten.
Sein Sohn, Dr. Paul Krüss tritt nach seiner Assistentenzeit an der
Universität Jena 1904 in das Geschäft ein. Paul Krüss heiratet
1906 die Tochter von Dr. Max Pauly, dem Leiter und Mitbegründer der
Astro-Abteilung von Carl Zeiss Jena. Im Jahre 1920 übernimmt jener Paul
Krüss die Hamburger Firma und beteiligt 1946 seinen Sohn Andres Krüss.
Mikroskope verschwinden nach dem II. Weltkrieg aus dem Programm, werden aber
Ende des 20. Jahrhunderts wieder angeboten. Seit 1980 führt in siebter
Generation Martina Krüss-Leibrock das Familienunternehmen. 2005 tritt
ihre Tochter Karin Leibrock als achte Generation in die Geschäftsleitung
ein. |








